Außenstelle Zelluläre Immuntherapie
Die Außenstelle Zelluläre Immuntherapie erforscht und entwickelt neuartige Methoden zur Herstellung von CAR-Immunzellprodukten, darunter nanopartikelbasierte Transfektions- und Squeezing-Techniken, für eine präzise Gen-Einführung. Die automatisierte Produktion von ATMPs sieht das Forschungsteam als Schlüssel, um diese Therapien vielen Patient*innen zugänglich zu machen. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt in der Entwicklung personalisierter Therapien durch das Konzept der adaptiven Herstellung von Zellprodukten. Diese Idee wird durch den Einsatz selbstlernender und automatisierter Fertigung unterstützt, beispielsweise gemeinsam mit dem AIDPATH-Konsortium.
_______________
Für unsere institutseigene Forschung sind wir offen für Kooperationen, insbesondere in den Bereichen Robotik und Künstliche Intelligenz. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
_______________
Unsere laufenden Projekte
Fraunhofer ATTRACT-Programm »CAR-Duett«
CAR-T-Zelltherapie ist für die Behandlung bestimmter Leukämien und Lymphome gut etabliert, dennoch kommt es bei vielen Patient*innen zu Remissionen, zum Beispiel durch Verlust des Antigens auf der Oberfläche. In soliden Tumoren wird die Immunzelltherapie zusätzlich durch das immunsuppressive Tumormikromilieu erschwert. Um diese Schwierigkeiten zu adressieren und die Entstehung von Tumorresistenz zu verhindern, werden in diesem Projekt verschiedene CAR-veränderte Immunzellen kombiniert. Dafür werden CAR-T-Zellen als Teil des adaptiven Immunsystem zusammen mit CAR-NK-Zellen (natürliche Killerzellen) aus dem angeborenen Immunsystem als sogenannte DUETT-Therapie eingesetzt. Diese Kombination vereint die Stärken beider Zelltypen in einem gemeinsamen Therapeutikum.
CAR FACTORY
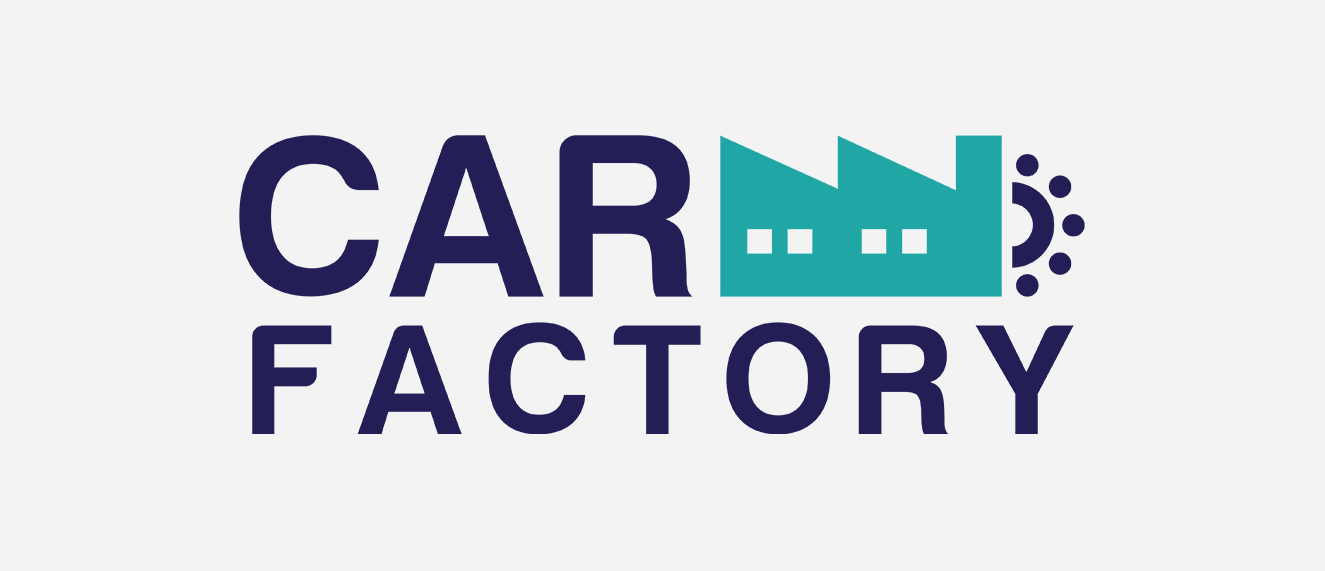
Nach dem äußert erfolgreichen Durchbruch der CAR-T-Zelltherapie für die Behandlung hämatologischer Indikationen verläuft die präklinische Entwicklung neuer CAR-Therapien, die auf Zielstrukturen außerhalb der etablierten Antigene CD19 und BCMA abzielen, vergleichsweise langsam, und nur wenige akademische Produktkandidaten erreichen eine Evaluierung im Rahmen von klinischen Studien. Das CAR FACTORY Konsortium setzt sich dafür ein, robuste akademische Arzneimittelentwicklungsprogramme aufzubauen, die innovative Ideen in wirksame Therapien für Patient*innen umwandeln. Der Fokus liegt dabei besonders auf seltenen und schwer behandelbaren Krebsarten, die in der CAR-Zellforschung bisher wenig Beachtung gefunden haben. Das Konsortium dient dabei auch als zentraler Ansprechpartner für Wissenschaftler*innen und Ärzt*innen, die Unterstützung bei präklinischen Studien suchen.
Projektpartner
Universitätsklinikum Frankfurt (Koordination); Universitätsklinikum Würzburg (Koordination); Universitätsklinikum Freiburg
- Mehr über CAR FACTORY.

Easygen – Easy workflow integration for gene therapy

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer integrierten und automatisierten Herstellungsplattform zur dezentralen Herstellung von CAR-T-Zelltherapeutika. Das System, welches in Krankenhäusern und medizinischen Zentren platziert werden kann, soll perspektivisch sowohl die Produktionszeiten wie auch die Kosten zur Herstellung zellbasierter Immuntherapeutika signifikant senken und damit den Zugang zu diesen lebenswichtigen Medikamenten erweitern.
Hierfür arbeitet ein von der EU gefördertes Konsortium bestehend aus 18 industriellen und akademischen Partnern unter der Koordination von Fresenius zusammen. Basis für das Projekt ist eine von Fresenius Kabi entwickelte Technologie, welche im Rahmen des Vorhabens weiterentwickelt wird.
Das Fraunhofer IZI bringt hierbei seine Expertise in der Entwicklung und Herstellung von CAR-T-Zelltherapien und verschiedenen anderen zellbasierten Therapeutika ein und übernimmt verschiedene Aufgaben innerhalb des Konsortiums. Dazu gehören unter anderem die Testung und Optimierung der Point-of-Care Herstellungsplattform und entsprechender Verbrauchsmaterialien sowie deren Validierung gegenüber herkömmlichen Herstellungsverfahren im zentralisierten Labor. Weiterhin wirkt das Fraunhofer IZI an der Erarbeitung von Studien und Konzepten mit, in deren Mittelpunkt die Integration der Plattform in die Arbeitsabläufe von Kliniken und regulatorische Aspekte stehen.
Mit dem Fraunhofer IESE ist ein zweites Institut der Fraunhofer-Gesellschaft beteiligt, welches einen digitalen Zwilling der Technologie entwickelt, anhand dessen weitere Optimierungen erfolgen.
Partner
Fresenius SE & Co. KGaA (Koordination); Helios Hospital Berlin-Buch; QS Instituto, Spanien; Fenwal Inc., USA; Cellix Ltd., Irland; Charles River; Pro-Liance Global Solutions; TQ Therapeutics; Philips Electronics Nederland B.V., Niederlande; Fraunhofer IESE; Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf; Technical University of Denmark, Dänemark; Frankfurt School of Finance & Management; European Society for Blood & Marrow Transplantation, Spanien; Bar-Ilan University, Isreal; University of Glasgow, Vereinigetes Königreich; University of Navarra, Spanien
Förderung
Das Projekt wird durch die EU im Rahmen der Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU) gefördert (grant agreement No 101194710).
- Mehr über Easygen.

Saxo Cell-Projekt »SB Tract«
Der Zukunftscluster SaxoCell ist ein Zusammenschluss führender Forschungsinstitute und medizinischer Einrichtungen aus Sachsen, unter anderem aus Leipzig, Dresden und Chemnitz. In dem Projekt SB-TRACT soll ein optimiertes, verkürztes Herstellungsprotokoll für CAR-T-Zellen unter Verwendung eines virusfreien, Transposase-basierten Gentransfers mittels Polymernanopartikel (PNP) für die Behandlung solider Tumore erarbeitet werden. Das strategische Ziel ist, innovative T-Zellprodukte in klinische Produkte des Zukunftsclusters zu überführen. Neben dem Fraunhofer IZI Leipzig und der Würzburger Außenstelle sind die Universität Leipzig und die Industriepartner Haema AG, T-CURX GmbH und TheryCell GmbH beteiligt.