Nationale Strategie für gen- und zellbasierte Therapien
Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erarbeiteten gemeinsam ein Strategiepapier, um die Translation neuer Erkenntnisse aus der Forschung in die Krankenversorgung zu verbessern. Das Ergebnis wurde am 12. Juni 2024 im Futurium Berlin an Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger übergeben.
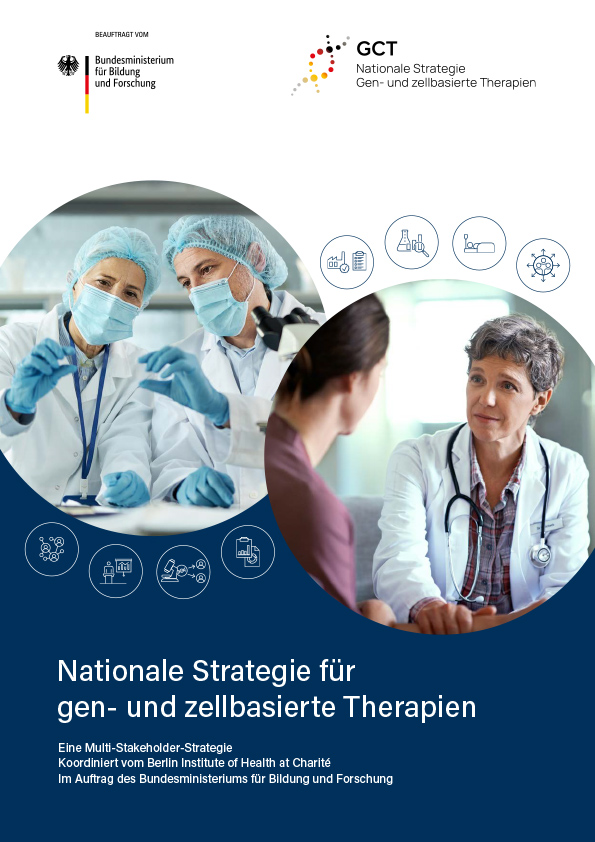
Gen- und zellbasierte Therapien (Gene and Cell-based Therapies, GCT) sind Schlüsseltechnologien für Innovationen in der biomedizinischen Forschung und Krankenversorgung. Sie bieten vielversprechende Ansätze zur Behandlung von bisher unheilbaren Krankheiten. Zugleich besteht noch großer Forschungsbedarf zur Verbesserung von Effizienz, Sicherheit und breiter Verfügbarkeit. Obwohl Deutschland in der Grundlagenforschung sowie verschiedenen technologischen Entwicklungen führend ist, bestehen besondere Herausforderungen bei der Umsetzung in die medizinische Versorgung und wirtschaftliche Wertschöpfung. Dies könnte dazu führen, dass Deutschland international den Anschluss in diesem Bereich verliert und die Versorgung von Patient*innen beeinträchtigt wird. Rund 150 Expert*innen aus unterschiedlichen Stakeholdergruppen haben im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung einen Fahrplan zur Stärkung des Standorts Deutschland im Bereich der gen- und zellbasierten Therapien entwickelt. Vom Fraunhofer IZI wirkten Institutsleiterin Prof. Dr. Ulrike Köhl, PD. Dr. Stephan Fricke (Leitung Abteilung Zell- und Gentherapieentwicklung) sowie Prof. Dr. Michael Hudecek (Leitung Außenstelle Zelluläre Immuntherapie) mit.
Zell- und Gentherapien haben in den vergangenen Jahren insbesondere die hämatologische Onkologie um zahlreiche erfolgsversprechende Therapieoptionen bereichert. Dadurch hat sich weltweit ein dynamisches Forschungsfeld entwickelt. Die zunehmende Anzahl klinischer Studien lässt gleichzeitig auf eine Zunahme neuer Zulassungen für gen- und zellbasierte Therapien hoffen. Damit einher geht jedoch auch ein erhöhter Bedarf an pharmazeutischen Herstellungskapazitäten, sowohl im kleineren Maßstab für klinische Studien als auch für die breite kommerzielle Produktion. Ulrike Köhl, Leiterin des Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie, brachte ihre Expertise in das Handlungsfeld »Ausbau von Qualität und Kapazität der GMP-Produktion« ein.
»Die Gewährleistung ausreichender Herstellungskapazitäten zur Produktion von Zell- und Gentherapeutika sowie deren kritischer Ausgangsstoffe ist von hoher Relevanz für die technologische Souveränität Deutschlands in diesem Bereich. Um dabei alle notwendigen Aspekte der Wertschöpfung zu berücksichtigen und begrenzte Ressourcen effizient einzusetzen, sollte ein Ausbau entsprechender Infrastrukturen über die Bundesländergrenzen hinweg koordiniert und zwischen den Akteuren abgestimmt erfolgen.«
Damit neuartige Zell- und Gentherapien in die klinische Anwendung gelangen und damit auch in die wirtschaftliche Verwertung bedarf es eines stringenten Technologietransfers. Im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern kann der Forschungsstandort Deutschland in dem Bereich aktuell nicht mithalten. Deshalb bedarf es verschiedenster Maßnahmen, um neben exzellenten Forschungsergebnissen auch die entsprechende Wertschöpfung in Deutschland und Europa zu ermöglichen. Stephan Fricke, Leiter Abteilung Zell- und Gentherapieentwicklung am Fraunhofer IZI, wirkte im Handlungsfeld »Technologietransfer« mit.
»Die Entwicklung stabiler und skalierbarer Herstellungsprozesse gemäß GMP (Good Manufacturing Practice) ist ein essentieller Schritt für den Transfer von Forschungsergebnissen in die klinische Anwendung. Für einen effizienten Technologietransfer sollte dieser bei der Entwicklung neuer Zell- und Gentherapien frühzeitig mitberücksichtigt werden. Dafür braucht es entsprechendes Know-how und eine geeignete Infrastruktur.«
Als weiteres strategisches Ziel wurde die Verbesserung struktureller Voraussetzungen für die translationale Forschung definiert. Hierzu gehört die Etablierung eines nationalen Netzwerks, um sowohl den fachlichen Austausch zu fördern als auch organisatorische und regulatorische Aspekte zu harmonisieren und verbessern. Zudem sollen die Voraussetzungen für einen Mentalitätswechsel unter Forschenden geschaffen werden, unternehmerisch aktiv zu werden. Es bedarf bei allen Akteuren mehr Mut zum Risiko, damit das Wissen und die Wertschöpfungskette in Deutschland bleiben. Michael Hudecek, Leiter der Würzburger Außenstelle Zelluläre Immuntherapie, wirkte am Handlungsfeld »Forschung und Entwicklung« mit.
»Um die Kernkompetenzen in der Entwicklung und Herstellung von Zell- und Gentherapien an den verschiedenen nationalen Standorten weiter auszubauen, müssen dezentrale Hubs geschaffen werden, deren Infrastruktur mit allen anderen Akteuren geteilt wird. Der Bedarf an gen- und zellbasierten Therapien wird steigen. Um hier weder zeitlich noch finanziell von Herstellern im Ausland abhängig zu sein, müssen die Kapazitäten in Deutschland ausgebaut werden.«